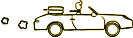«Touring»-Leserquiz
Kreuzen Sie die richtige Antwort an, und nehmen Sie an den Verlosungen
in der aktuellen Ausgabe des Touring-Magazins teil. Viel Glück!


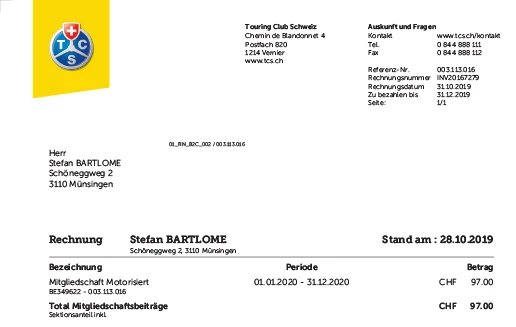
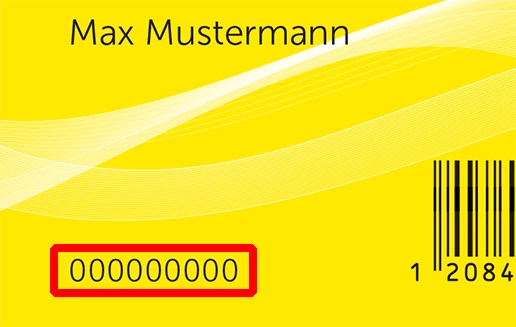
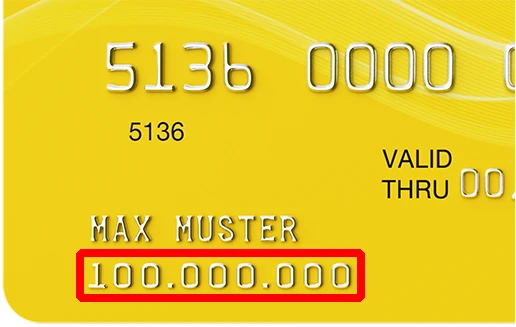
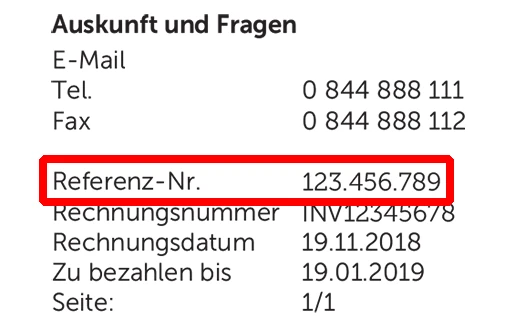
Interview: Dino Nodari
Fotos: Emanuel Freudiger
Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) hat die ETH Zürich unter Leitung von Professor Ulrich Weidmann rund 500 Verkehrsprojekte im Strassen-, Schienen- und Agglomerationsverkehr für den Zeitraum bis 2045 bewertet und priorisiert. Das Programm «Verkehr ’45» soll sicherstellen, dass bei knapperen Mitteln jene Vorhaben umgesetzt werden, die den grössten Nutzen für Mobilität, Wirtschaft und Umwelt bringen.
Die Analyse folgte auf die abgelehnten Ausbaupläne für Nationalstrassen und die fast verdoppelten Kosten im Bahnbereich. Ulrich Weidmann legte Kriterien wie Wirksamkeit, Nutzen-Kosten-Verhältnis, Umweltverträglichkeit und regionale Bedeutung zugrunde. Dringlich seien Massnahmen in wachstumsstarken Räumen wie Zürich, Genfersee und der Nordwestschweiz.
Der Bericht betont, dass mit vorhandenen Mitteln ein zukunftsfähiger Ausbau möglich ist – sofern Projekte koordiniert, verschoben oder reduziert werden. Für den Zeitraum bis 2045 sieht das UVEK laut dem Weidmann-Bericht neun Milliarden Franken für Nationalstrassen,
14 oder 24 (mit der Verlängerung des MwSt.-Promille) Milliarden Franken für Bahnprojekte und 7,5 Milliarden Franken für Agglomerationsprogramme vor. Aufgrund der Projektpriorisierungen und mit Blick auf die verkehrspolitischen Ziele empfiehlt das Gutachten eine Fokussierung auf grosse, strukturell wirksame Projekte, ergänzt durch gezielte Ausbauten in kapazitätskritischen Netzbereichen: Ausbauprojekte mit strukturellen Wirkungen ermöglichen langfristig orientierte und planerisch robuste Verbesserungen. Dies eröffne für die folgenden Jahrzehnte neue Spielräume. Einige Schlüsselprojekte beheben Engpässe in Knotenpunkten und verbessern damit Kapazität und Qualität des ganzen Netzes. Andere priorisierte Vorhaben stärken die Resilienz und erleichtern die Erhaltung bestehender Infrastrukturen. Der Bundesrat will die Analyse als Grundlage für die Entscheide zu Finanzierung und Ausbauplänen nutzen. Die konkreten Ausbauschritte sollen im nächsten Jahr in einer Vernehmlassung gebündelt werden.

Sie haben sich eingehend mit unserem Verkehrssystem auseinandergesetzt. Stehen wir so nah am Kollaps auf Strasse und Schiene, wie man gelegentlich meinen könnte?
Ulrich Weidmann: Kollaps ist wohl etwas missverständlich. Das würde ja bedeuten, dass plötzlich alles stillsteht. Die Entwicklung verläuft eher schleichend. Klar ist, dass es vor allem in den Agglomerationen – getrieben durch das Bevölkerungswachstum – oft zu Staus kommt. In diesen Fällen stossen auch die Ausweichrouten an ihre Belastungsgrenzen. Geschieht dann noch ein Unfall oder es gibt Schnee, geht plötzlich tatsächlich nichts mehr. Der Alltag zeigt, wie clever sich die Automobilisten bei der Suche nach der besten Ausweichroute verhalten. Das System funktioniert dadurch noch, aber es wird immer labiler, und die Wohnquartiere leiden. Und beim Bahnverkehr müssen wir uns vielleicht auch eingestehen, dass wir eher verwöhnt waren in den letzten Jahren, wenn man es mit dem Ausland vergleicht. Ich gehe davon aus, dass wir zu gewissen Zeiten mit einem etwas tieferen Komfort auskommen müssen, weil es kaum mehr kurzfristige Möglichkeiten zur Verdichtung gibt. Um allerdings mehr Fahrgäste zum Umsteigen zu gewinnen, braucht es hier Massnahmen.
Die an der Urne abgelehnten Projekte zum Autobahnausbau gaben den Anlass zu Ihrer Analyse. Jetzt sind nur zwei dieser Projekte in der höchsten Priorität. Sind die restlichen vier also nicht so wichtig und dringend?
Nein, die sind auch wichtig, aber nicht ganz so dringend. Es ist eine Frage der Perspektive. Wir haben den Fokus auf die Fertigstellung des Verkehrsnetzes, auf Lücken im System gelegt, ebenso auf Stellen, wo bald die Gesamterneuerung bestehender Abschnitte ansteht. Unter den sechs Projekten gab es ja auch Kapazitätsausbauten, wo wir vorschlagen, dass die Prioritäten in den nächsten zwanzig Jahren etwas reduziert werden könnten. Mit Pannenstreifenumnutzung oder anderen betrieblichen Massnahmen können relativ rasch Optimierungen erreicht werden.
Die Zeit drängt also nicht?
Im Bericht haben wir festgehalten, dass man mit unserer Priorisierung etwas Zeit gewinnen kann, es aber schon drängt. Explizit haben wir Abschnitte benannt, bei denen nach 2045 bauliche Massnahmen kaum zu umgehen sind. Es gibt aber auch Abschnitte, wo der öffentliche Verkehr einen Teil der zusätzlichen Nachfrage abdecken kann. Mit einer Entlastung im Sinn einer Reduktion ist zwar nicht zu rechnen, aber mit einem Einpendeln auf hohem Niveau.
Welchen Stellenwert haben die Autobahnen im Verkehrssystem?
Der Individualverkehr macht in der gesamten Verkehrsleistung rund drei Viertel aus. Und die Hälfte davon findet auf der Autobahn statt. Man kann die Autobahnen also zusammen mit den Hauptstrecken der Bahn als Haupterschliessungssystem bezeichnen. Allerdings denkt man bei Autobahnen oft an die langen Fahrten. Diese Funktion haben sie auch, aber nicht nur. Schaut man genau hin, sieht man, dass der grösste Teil des Autobahnverkehrs regionaler Verkehr ist. Autobahnen können also auch als schnelle, regionale Umfahrungsstrassen bezeichnet werden.
Welchen Einfluss hatten diese Überlegungen beim Gutachten?
Wir schlagen vor, die beiden Autobahnprojekte Rheintunnel in Basel und Rosenbergtunnel in St. Gallen wieder anzuschauen. Sie bieten eine Entlastung des städtischen Verkehrsnetzes – nicht nur eine Entlastung der Stadt vom Langstreckenverkehr, sondern vor allem auch vom Kurzstreckenverkehr. Das ermöglicht wiederum Spielräume in der Gestaltung des innerstädtischen Verkehrsnetzes, und es sind Vorinvestitionen in künftige grosse Erneuerungen.
Seit 2019 haben sich die Staustunden auf den Autobahnen verdoppelt, eine Trendumkehr scheint sich nicht abzuzeichnen.
Die Netzkapazität war eines der Kriterien, die wir untersucht haben. Allerdings weniger die Staustunden an sich als die Stabilität des Verkehrsträgers. Stau auf Autobahnen führt dazu, dass das Verkehrsnetz als Ganzes nicht mehr stabil läuft, weil der Ausweichverkehr auf Strassenabschnitte führt, die dafür nicht gedacht sind. Hier sehen wir mittelfristig die Pannenstreifenumnutzung und betriebliche Massnahmen vor. Allerdings verbunden mit dem Signal an die Politik, dass bei einigen Abschnitten Handlungsbedarf besteht, der angepackt werden müsste, wenn es der finanzielle Rahmen zulassen würde. Es gibt aber auch Abschnitte, auf die wir mit Blick auf den Bahnausbau ganz verzichten würden.

Alles spricht derzeit von Digitalisierung und Automatisierung von Transportsystemen. Wurden diese Trends bei der Analyse miteinbezogen?
Wir haben den Zeitrahmen bis 2045 untersucht. In den nächsten zwanzig Jahren kommt zuerst die Bauzeit, und erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts werden wir über die Wirkung sprechen können, und dies war auch unser Fokus. Deshalb sind wir schon davon ausgegangen, dass bis dahin grosse Schritte passiert sein werden bei der Digitalisierung und der Automatisierung. Diese Aspekte – mit allen Spekulationen, die damit verbunden sind – haben wir bei der Bahn etwas stärker berücksichtigt als auf der Strasse.
Warum?
Da, wo es um Kapazitätsausbauten ging, konnten wir bei Bahnprojekten teilweise depriorisieren, weil wir davon ausgehen, dass bis 2045 auf der Schiene viel automatisiert werden könnte.
Nicht so auf der Strasse?
Da bin ich, ehrlich gesagt, noch etwas unschlüssig, wie die Auswirkungen der Digitalisierung sein werden, vor allem bei der benötigten Kapazität. Grossen Einfluss und viele Vorteile werden diese Entwicklungen auf die Verkehrssicherheit haben oder beim Energieverbrauch. Bei der Kapazität scheint es mir noch nicht ganz eindeutig zu sein.
Wo stehen wir bei der Entwicklung der Automatisierung?
Diese Entwicklung ist in vollem Gang und heute zum Teil schon serienmässig im Auto eingebaut oder als Option erhältlich. Aber auch hier gehe ich von einer schleichenden Transformation aus, die erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zum Tragen kommen wird. Die Automatisierung wird wohl kaum mit einem Knall kommen.
Wenn man davon ausgeht, dass auch der ÖV automatisiert wird, vielleicht auch mit kleineren Fahrzeugen, ergibt es dann Sinn, den Verkehr zu den grossen Hubs oder Bahnhöfen in Innenstädten zu leiten?
Wo eine sehr hohe Leistungsfähigkeit gebraucht wird, etwa bei S-Bahnstrecken, da, wo pro Tag mit Zehntausenden Personen gerechnet wird, bieten kleinere Fahrzeuge auf Strasse oder Schiene keinen Vorteil. Auf solchen Strecken ist die Bündelung in einem grossen Fahrzeug unschlagbar in Sachen Leistungsfähigkeit. Da dürfte man bei grossen Einheiten bleiben, die aber optimierter betrieben werden. Grosse Veränderungen sind für mich aber in der regionalen Erschliessung denkbar. Mit autonomen Fahrzeugen könnte sich die Feinverteilung stark verändern. Die letzte Meile ist immer noch eines der grössten Handicaps für den öffentlichen Verkehr. Da stelle ich mir eher die Frage, ob die Bahn noch das richtige Verkehrsmittel ist. Autonome Fahrzeuge könnten neue Zubringersysteme schaffen und etwa das bisherige Park-and-Ride-Modell stark verbessern, indem Fahrzeuge nach der Ankunft am Bahnhof weiterfahren statt geparkt werden.
Andere Länder sind da viel weiter. Verschlafen wir diesen Trend gerade?
Ich habe schon das Gefühl, dass man dieses Thema offensiver angehen könnte. Nicht in dem Sinne, dass wir diese Systeme entwickeln, dafür ist die Schweiz zu klein. Aber in der Anwendung sind wir schon etwas zurückhaltend. Das liegt wahrscheinlich zum einen am Nutzen, der noch nicht sehr präsent ist, und zum anderen ist uns auch noch nicht richtig bewusst, dass sich die Mobilität dadurch stark verändern wird und es wohl andere Systeme sein werden, die uns effizienter befördern als heute. Dafür braucht es aber nicht nur Nutzen und Bewusstsein, sondern auch grössere Investitionen.
Gilt das auch für die Schiene?
Auch da ist es mit grossen Investitionen verbunden, die zuerst einmal getätigt werden müssen. Und diese Investitionen kommen zunächst immer noch oben drauf, erst später werden sie Einsparungen bringen. Bei der Bahn stelle ich es mir so vor, dass es ähnlich sein wird wie der Autopilot im Flugzeug. An bestimmten Stellen im Netz wird der Autopilot übernehmen, es wird aber noch länger so sein, dass Personal auf den Zügen ist.
Wo wird der Autopilot übernehmen?
Entscheidend für die Kapazität sind Knotenbereiche, also die grossen Bahnhöfe. Will man da an Kapazität gewinnen, muss sichergestellt werden, dass ganz präzise die richtigen Slots erwischt werden. Diese Slots ändern sich aber unablässig. Solche Systeme müssen interagieren, ständig die optimierten Slots errechnen und gleichzeitig den Zug so steuern, dass die passenden Slots erwischt werden. So etwas kann der Mensch nicht leisten.
Wir müssen uns also damit abfinden, dass vorerst Staustunden weiter steigen und die Züge überfüllt sind?
Es wäre unehrlich, zu sagen, dass es besser wird. Ich schätze, dass die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre eher schwierig und unkomfortabler werden. Erst dann rechne ich damit, dass Schritt für Schritt ein Projekt nach dem anderen zum Tragen kommt.

Ein Strom voller Wunder
Auf einer Mekong-Flusskreuzfahrt erleben die Passagiere unzählige Begegnungen mit den Menschen, der Kultur und dem Leben am und auf dem riesigen Strom

Fahrbericht Honda CB1000GT
Der Tourer Honda CB1000GT verwandelt sich mit einer Handgelenkbewegung in einen feurigen Sportler. Ein Sporttourer moderner ...

Zwei Generationen, eine Passion
Michael und Matthias Hansen bilden das einzige Vater-Sohn-Gespann der TCS Patrouille.

Fahrtrainings Schnee und Eis
In herrlicher Lage am Grossen Sankt Bernhard befindet sich die TCS-Piste, auf der das Autofahren bei winterlichen ...