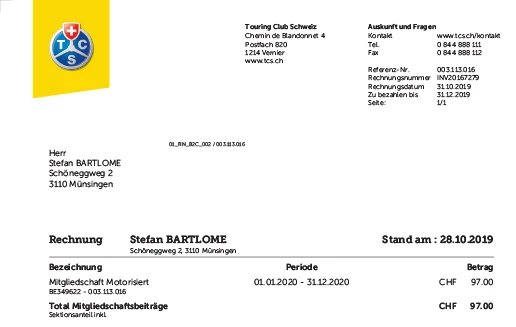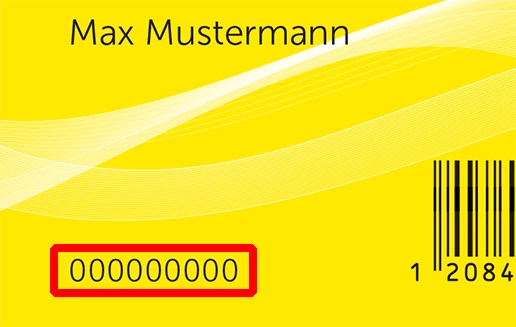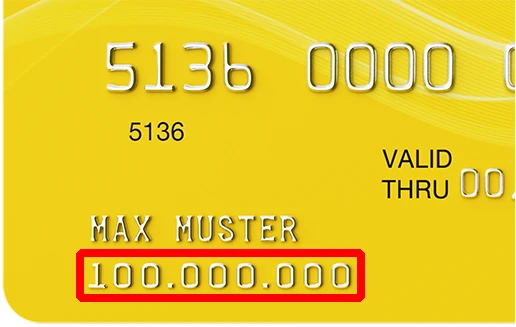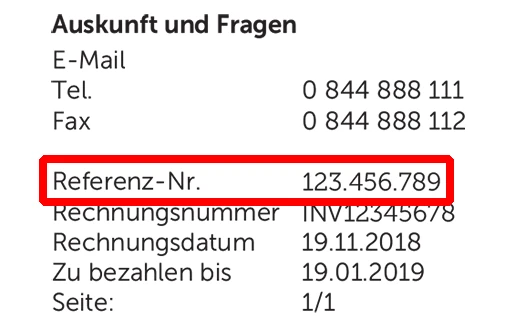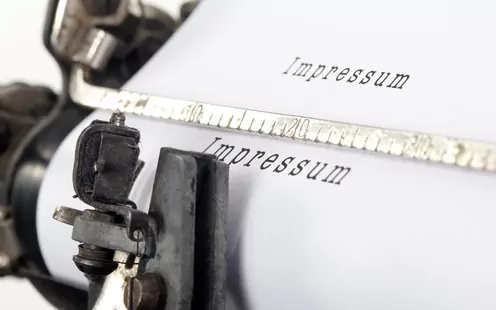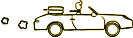08.05.2025
Mehr Sicherheit für Strassenarbeiter
Ihr Job ist immens wichtig, aber höchst gefährlich. Jedes Jahr verliert in der Schweiz ein Strassenarbeiter sein Leben. Im Kanton Zürich passiert fast täglich ein Unfall im Baustellenbereich auf Strassen. Der Grund: Unachtsamkeit von Autofahrerinnen und Autofahrern. Um das Leben der Mitarbeitenden besser zu schützen, sensibilisiert jetzt das Tiefbauamt des Kantons Zürich mit einer neuen Kampagne für das Thema und setzt auf Models aus den eigenen Reihen. Diese sind auf Plakaten auf Kantonsstrassen, an Autobahneinfahrten und an Rastplätzen zu sehen, auf denen steht: «Wir arbeiten für Sie. Achten Sie auf unsere Sicherheit.»
07.05.2025
Deutsche Autobauer leiden heftig
BMW meldet für das erste Quartal 2025 einen Gewinneinbruch von 26,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Lediglich 2,2 Milliarden fuhr der Konzern ein. Grund ist vor allem der schwache Absatz in China. Verglichen mit anderen geht es den Bayern aber noch einigermassen gut. Bei Volkswagen verringerte sich der Gewinn in den ersten drei Monaten des Jahres um knapp 41 Prozent und bei Mercedes-Benz sogar um fast 43 Prozent.
05.05.2025
Ende 2025 Aus für die «rollende Autobahn»
Aufgrund unerwartet vielen Einschränkungen auf dem Schienennetz kann das Unternehmen RAlpin, die «Rollende Autobahn» (Rola), also den Bahnverlad von Lastwagen für die Fahrt durch die Alpen, nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Daran ändern auch die Finanzhilfen des Bundes nicht. Deshalb wird in Absprache mit dem Bund, die Rola statt Ende 2028 bereits Ende 2025 eingestellt.
02.05.2025
Premium zieht, BMW liegt vorn
Schweizer Autokäufer/innen mögen es gediegen und flott motorisiert, auch wenn es etwas kostet. Dieses Jahr mehr denn je, jedenfalls an der Spitze der Verkaufsstatistik. Dort hat nach dem ersten Trimester BMW den langjährigen Marktführer Volkswagen abgelöst. Die Bayern erreichen einen Marktanteil von 9,9 %, VW 9,6 %. Ende letzten Jahres hatte VW noch etwas Reserve, lag mit 10 % Marktanteil vor BMW mit 9,1 %. Insgesamt liegen die Autoverkäufe um 7,6 % unter Vorjahr.
01.05.2025
Autowahl: Junge ticken (ein bisschen) anders
Oft belegen Studien, dass Junge gar nicht gänzlich anders denken als ältere Generationen. Darauf deutet auch eine Umfrage des Forschungsinstituts TX Group Market Research im Auftrag von AutoScout24 hin. Gefragt nach den wichtigsten Kriterien beim Autokauf antworteten 18- bis 29-Jährige (Generation Z) ähnlich wie die übrigen Altersgruppen mit Kostenfragen, derweil Sicherheit eine etwas geringere Rolle spielt. Bei den Informationskanälen unterscheiden sich die Generationen: Insgesamt stehen die Garagen an erster Stelle, bei der Generation Z spielen aber digitale Inhalte, insbesondere Social Media und Influencer, eine grössere Rolle. Bei den Jungen ebenfalls wichtiger: Spass und Prestige.
30.04.2025
ÖV: Sicherheit selbst in der Hand
Wenn sich Reisende in Bus oder Tram verletzen, muss dies nicht Folge eines Zusammenstosses sein. Oft sind Stolperer beim Ein- und Aussteigen oder Umfaller nach Notstopps die Ursache, wie der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) schreibt. In einer Sicherheitskampagne macht der VöV auf diese Risiken aufmerksam und gibt Tipps, wie man es in Bus und Tram richtig macht. Festhalt spielt eine wichtige Rolle. Das Motto der Kampagne deshalb: "Sie haben es in der Hand".
24.04.2025
Verunsicherung trifft Nutzfahrzeugmarkt
Der Schweizer Markt für neue Nutzfahrzeuge hat im ersten Quartal 2025 einen herben Dämpfer erlitten. Nachdem 2024 noch mit einer roten Null zum Vorjahr abgeschlossen werden konnte, sind die Neuimmatrikulationen mit einem Minus von 17,8 Prozent nach drei Monaten nun regelreicht eingebrochen. Der Rückgang betrifft alle Fahrzeugkategorien gleichermassen, doch eine besonders: Die Zahl neuer Camper brach um mehr als ein Drittel ein.