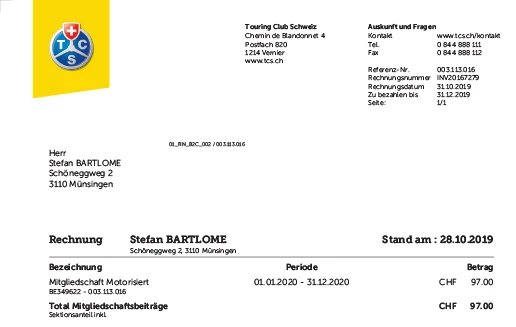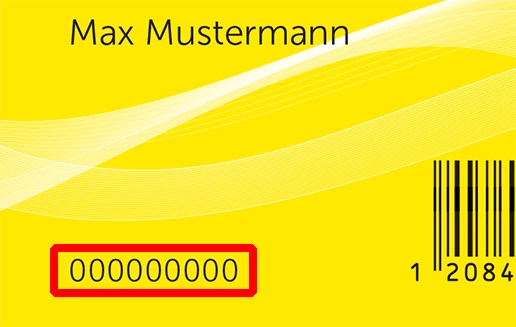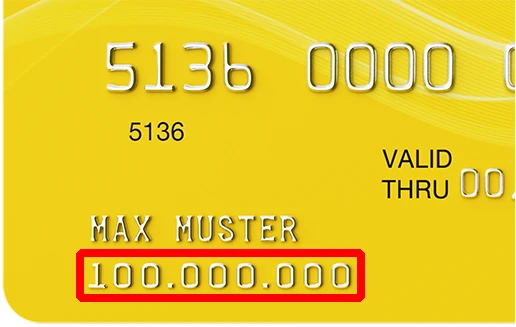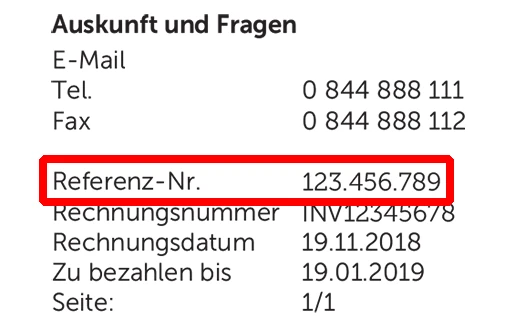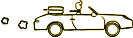Das ist kein Sonderangebot, zumal der ë-C3 Licht und Schatten zeigt. Der neue C3 ist grösser als seine Vorgänger, somit fällt Ein- und Aussteigen leicht, die Übersicht vom Fahrerplatz aus ist gut. Dieser allerdings ist, trotz der Komfortsitze der Topversion, nicht allzu bequem und beschränkt einstellbar. Auf der Rücksitzbank ist längs so viel Platz wie sonst in der Kompaktklasse. Das schmale Fahrerdisplay wirkt wie eine Sparmassnahme, ist aber bestens ablesbar und macht sich funktional so nützlich wie ein (teures) Head-up-Display. Im Zentraldisplay gibt es nicht allzu viel einzustellen, doch die Verbindung zu Android Auto und Apple CarPlay erweitert den Funktionsumfang.
Keine Enttäuschung ist der Elektroantrieb: Die Leistungswerte sind unspektakulär wie der gemessene Vortrieb, doch weder beim Ampelstart noch auf der Beschleunigungsspur kommt das Gefühl von Verzicht auf. Dazu rollt der Citroën leise und federt angenehm.
Verzicht herrscht hingegen hinsichtlich der Kernkompetenz von Elektroautos. Derweil die Akkugrösse okay und die Reichweite für einen Kleinwagen nicht entscheidend ist, sehen wir Probleme an der Ladesäule. Die versprochenen hundert Kilowatt Ladeleistung ist mangels Batterievorkonditionierung selbst bei mildem Winterwetter unerreichbar. Zügiges Laden auf Reisen bleibt somit ein Sommertraum.
Alles in allem ist der Citroën ë-C3 für ein in Europa gebautes Elektroauto konkurrenzfähig eingepreist. Etwas ernüchternd fällt hingegen der Vergleich mit dem konventionell angetriebenen C3 aus. In der Basisversion You kostet der Wagen als Verbrennerversion mit 100-PS-Turbobenziner und vergleichbaren Fahrleistungen 15 990 Franken. 24 990 Franken für den Stromer entspricht satten 56 Prozent Aufpreis.
Apropos E-Plattform für Kleinwagen
Variabel
Der neue C3 steht auf der CMPSmart-Plattform des StellantisKonzerns, geeignet für Kleinwagen diverser Marken und unterschiedlicher Antriebe, Hybride wie Stromer. Verfügbar für Citroën, Peugeot, Opel oder Fiat. Die Elektrovariante setzt dabei auf LFP-Batterien.
Lieber heiss als kalt
LFP steht für Lithium-IonenBatterien mit Ferrophosphat als Kathodenmaterial. Solche Akkus weisen eine geringere Energiedichte auf als die im Autobau häufigen NMCBatterien, sie sind dafür weniger empfindlich bezüglich Hitze und versprechen mehr Ladezyklen, sprich eine höhere Lebenserwartung. Kälte mag LFP hingegen weniger.
Der Kostenfaktor
Im Kleinwagensegment zählt jeder Franken, für Hersteller wie Konsumenten. Genau hier kommt eine weitere Stärke von LFP-Batterien zum Tragen. Sie kosten weniger. Laut einer Consultingfirma lagen 2024 die Preise für LFP-Zellen rund vierzehn Prozent (oder zehn US-Dollar pro Kilowattstunde) tiefer als jene für NMC.
Text: Daniel Riesen